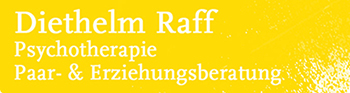Viele Eltern und Lehrer verzweifeln, wenn ihre Kinder und Schüler trotz vieler Bemühungen, spezieller Förderung und schulpsychologischer Betreuung nicht gerne in die Schule gehen und nicht richtig lernen können. Die Lernprobleme sind oft hartnäckig, die Möglichkeiten und Fähigkeiten zu helfen scheinen ausgeschöpft, das psychologische Wissen ist zu gering, so dass viele fälschlicherweise meinen, es liege
Psychologie | Psychologische Beratung Raff - Meilen - Part 2
- Von: Diethelm Raff
- Beratung, Kinder und Jugendliche, Psychologie
- Von: Diethelm Raff
- Beratung, Psychologie
Wie kann man Ärger und Wut verstehen?
Alle kennen Ärger. Man kommt in Aufregung wegen kleinerer und grösserer Ungereimtheiten im Leben: Wenn die Ampel auf rot steht, wenn man an der Kasse warten muss, wenn der andere einen nicht versteht, wenn man etwas nicht findet und ähnliches. Manchmal wird man auch wütend. Ärger und Wut sind interessante Phänomene, die psychologisch erklärbar sind.
- Von: Diethelm Raff
- Beratung, Psychologie
Der Mensch ist erst durch den anderen
Er ist nichts weniger als „Spezialist für die Psychologie der Gefühle“: Professor der Philosophie, Knut Eming, aus Heidelberg erklärte kürzlich in einem Vortrag, „Wie Gemeinschaft gelingen kann“. „Nur weil wir andere Menschen haben, können wir merken, wer wir sind“ ist eine zentrale Aussage Knut Emings. Wir finden uns nicht, wenn wir uns in uns selbst
- Von: Diethelm Raff
- Eifersucht, Kinder und Jugendliche, Paarberatung, Psychologie, Therapy
Entstehung und Überwindung der Eifersucht
Oft können wir die Eifersucht bei Kindern beobachten: Ein Kind nimmt seinem Freund das Spielzeug weg, weil es sich benachteiligt fühlt. Ein anderes Kind kann plötzlich nicht mehr mitspielen, weil ihm etwas weh tut, denn es glaubt, dass sein Geschwister zu sehr im Mittelpunkt steht. Ein drittes schreit laut oder wird hyperaktiv, wenn sich der
- 1
- 2